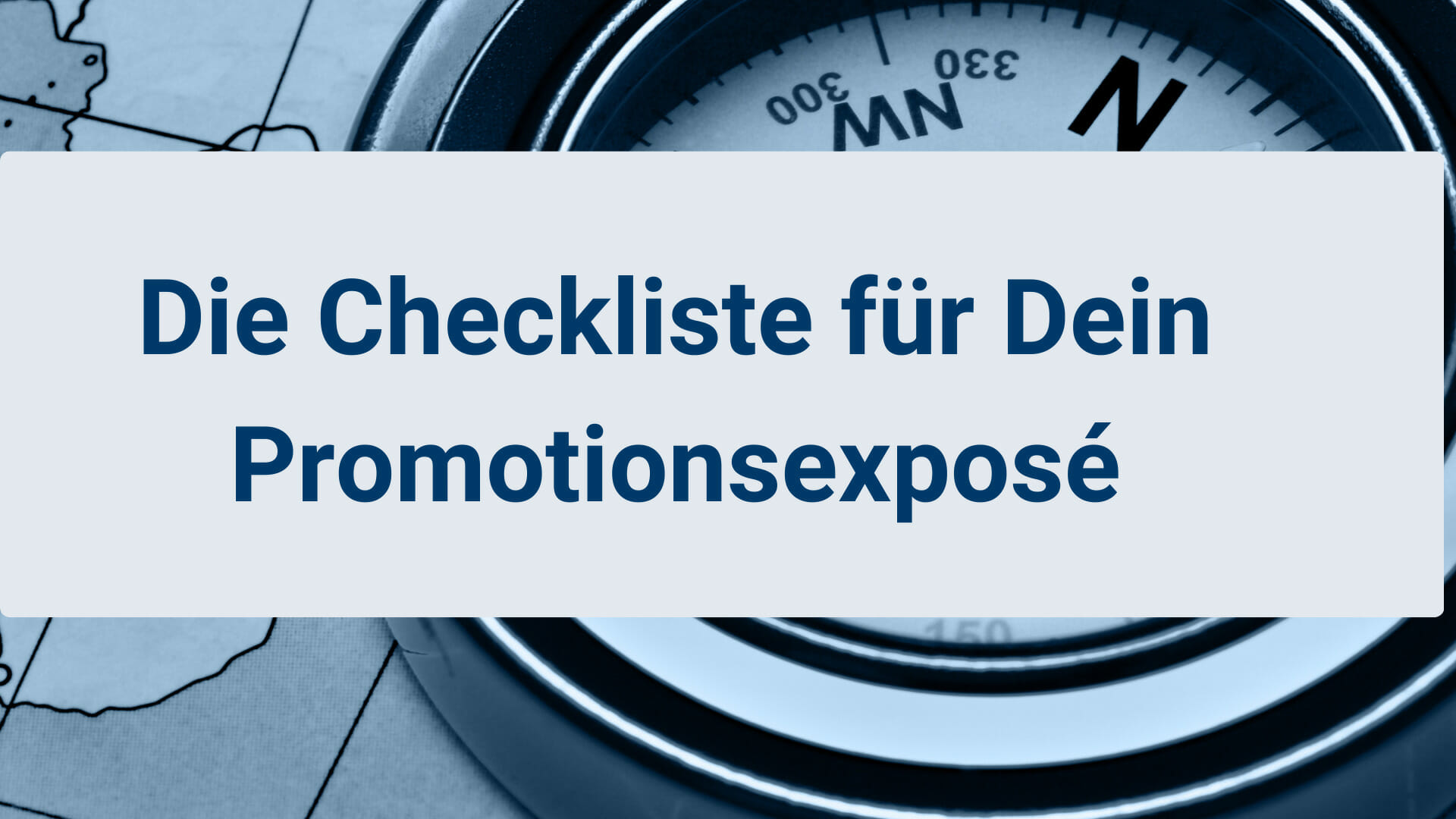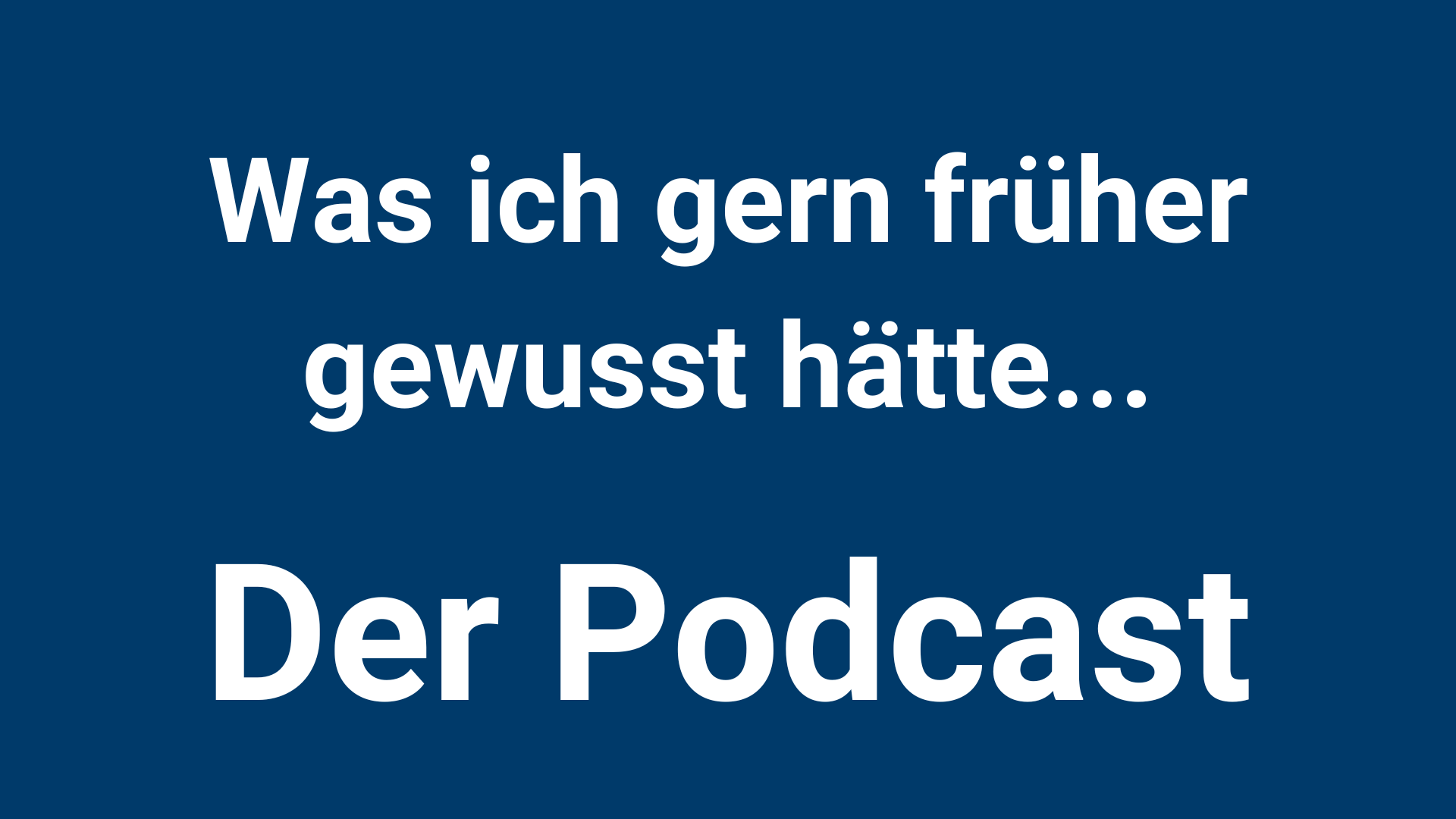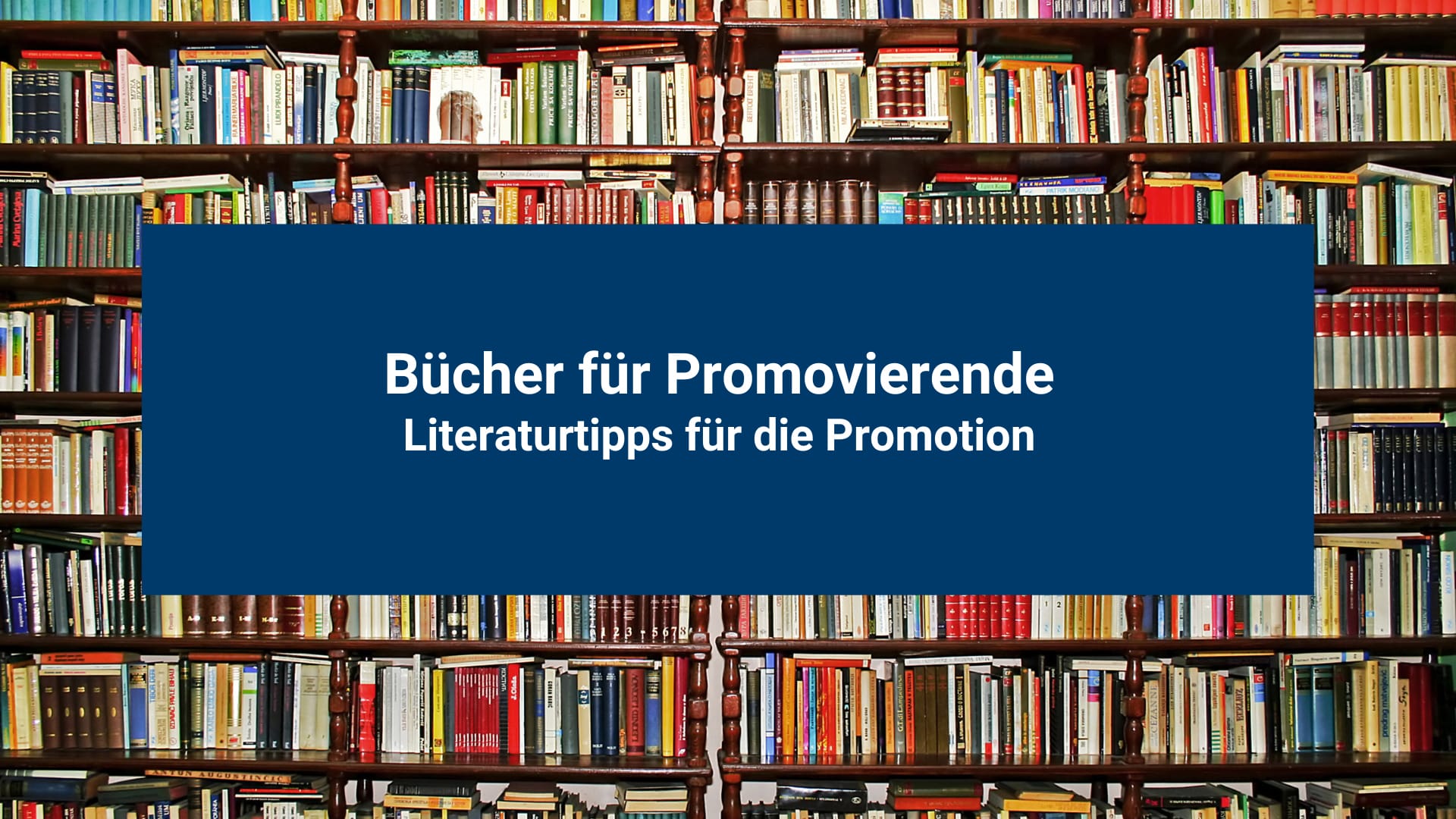In der Promotionsphase gibt es neben den offiziellen Anforderungen eine ganze Welt ungeschriebener Regeln und Konventionen. Dieses implizite Wissen entscheidet oft darüber, wie reibungslos der Promotionsprozess verläuft.
Der Zugang zu diesem Wissen hängt davon ab, auf wie viel Promotionserfahrung Du zurückschauen kannst oder auch, ob Du extern berufsbegleitend oder als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter promovierst. fakt ist: Wer die informellen Spielregeln der Wissenschaft kennt, kann gezielter agieren, Zeit sparen und selbstbestimmter durch die Promotion navigieren.

Implizites Wissen in der Promotion:
Ungeschriebene Regeln der Wissenschaft verstehen und nutzen
Was ist implizites Wissen in der Wissenschaft?
Implizites Wissen umfasst all jene ungeschriebenen Konventionen und Verhaltensregeln, die in der Wissenschaft als selbstverständlich gelten und die nirgendwo offiziell dokumentiert sind. Es handelt sich um Erfahrungswissen, das normalerweise durch Beobachtung, informelle Gespräche oder familiäre Verbindungen zur Wissenschaft weitergegeben wird.
Konkrete Beispiele zeigen, wie vielfältig dieses Wissen ist: Wo sitzt man in einer Fakultätsratssitzung? Welche Plätze sind traditionell der Promotionsbetreuung vorbehalten? Wie verhält man sich in einem Kolloquium? Welche impliziten Erwartungen haben Betreuende an Promovierende? Welche unausgesprochenen Hierarchien gibt es? Wie funktioniert ein informelles Empfehlungssystem in der Wissenschaft?
Diese scheinbar kleinen Details können große Auswirkungen haben. Promovierende, die diese Codes nicht kennen, investieren oft unnötig viel Energie in Unsicherheit und Selbstzweifel, anstatt sich auf ihre Forschung konzentrieren zu können.
Typische Bereiche impliziten Wissens
Verhalten in wissenschaftlichen Kontexten: Kolloquien funktionieren nach eigenen Regeln. Während manche als konstruktive Diskussionsrunden angelegt sind, herrscht in anderen eine Kultur des kritischen Hinterfragens, die für Erstvortragende einschüchternd wirken kann. Wer diese Dynamiken versteht, kann sich besser darauf einstellen.
Kommunikation mit Betreuenden: E-Mails zu ungewöhnlichen Uhrzeiten, mehrdeutige Formulierungen oder implizite Erwartungen an Reaktionszeiten – die Kommunikation mit der Promotionsbetreuung folgt oft unausgesprochenen Regeln, die erst durch Erfahrung erschließbar werden.
Publikationsstrategien und Vernetzung: Wie baut man sich ein Forschungsnetzwerk auf? Wen spricht man auf Konferenzen an und wie? Welche Publikationsstrategie ist für das eigene Fach sinnvoll? Hier entscheidet oft der Zugang zu informellem Wissen über Erfolg oder mühsames Ausprobieren.
Finanzierungsmöglichkeiten: Viele Hochschulen und Universitäten verfügen über Töpfe zur Finanzierung von Konferenzteilnahmen, Forschungsaufenthalten oder Weiterbildungen. Wer diese Möglichkeiten kennt, kann sie nutzen – andere erfahren oft gar nicht davon.
Warum bleibt implizites Wissen oft verborgen?
Die Weitergabe impliziten Wissens erfolgt hauptsächlich durch persönliche Kontakte und informelle Gespräche. Promovierende, die als studentische Hilfskräfte (SHK) gearbeitet haben, oder mit anderen Zugängen zur Wissenschaft (Familie, Partner*innen) in Kontakt gekommen sind, haben einen besseren Einblick in wissenschaftliche Gepflogenheiten. Wer als erste*r in der Familie promoviert, muss sich dieses Wissen erst erschließen.
Besonders extern Promovierende oder jene, die wenig in universitäre Strukturen eingebunden sind, haben erschwerten Zugang zu informellem Wissen. Ihnen fehlen die beiläufigen Gespräche in der Mensa, die Beobachtungsmöglichkeiten in Kolloquien oder der Austausch im Forschungsteam.
Diese Wissenslücken sind kein individuelles Versagen, sondern ein strukturelles Problem. Wenn implizites Wissen nur zufällig weitergegeben wird, entstehen Ungleichheiten, die sich auf den gesamten Promotionsverlauf auswirken können.
Auswirkungen fehlenden impliziten Wissens
Wer die ungeschriebenen Regeln nicht kennt, investiert oft übermäßig viel Energie in Unsicherheit. Statt voranzugehen, bleiben Promovierende gedanklich auf der Stelle stehen und grübeln über das richtige Verhalten. Diese Energie fehlt dann für die eigentliche Forschungsarbeit.
Fehlende Kenntnisse können auch zu verlängerten Promotionszeiten führen. Wer erst durch Versuch und Irrtum lernen muss, was andere bereits wissen, benötigt mehr Zeit für Prozesse, die eigentlich routine sein könnten.
Nicht zuletzt verstärkt fehlendes implizites Wissen das Impostor-Syndrom. Wenn andere scheinbar mühelos navigieren, was einem selbst Schwierigkeiten bereitet, entstehen Selbstzweifel an der eigenen Kompetenz – obwohl es sich lediglich um unterschiedlichen Wissensstand handelt.
Strategien zum Erwerb impliziten Wissens
Aktive Vernetzung: Suche gezielt nach Communities von Promovierenden. Schreibgruppen, Promotionsgruppen oder Programme wie Fokus-Promotion bieten Austausch mit anderen, die ähnliche Fragen haben oder bestimmte Herausforderungen bereits gemeistert haben.
Mentoring nutzen: Peer-Mentoring mit anderen Promovierenden oder formelle Mentoring-Programme eröffnen Zugang zu Erfahrungswissen. Da offizielle Programme oft begrenzte Plätze haben, können selbst organisierte Peer-Mentoring-Gruppen eine wertvolle Alternative sein.
Beobachten und fragen stellen: Achte bewusst darauf, wie sich andere in wissenschaftlichen Kontexten verhalten, z. B. in Kolloquien, auf Tagungen oder im Austausch mit Betreuenden. Hab den Mut, Fragen zu stellen, auch wenn das zunächst Überwindung kostet. Oft sind andere dankbar, dass jemand eine Frage stellt, die sie sich ebenfalls nicht zu stellen trauten.
Online-Ressourcen nutzen: Podcasts, Blogs und Workshops vermitteln nicht nur explizites Wissen, sondern geben auch Einblicke in wissenschaftliche Routinen und Strategien. Der Coachingzonen-Podcast oder Blogbeiträge können wertvolle Quellen für implizites Wissen sein.
Fachgesellschaften einbeziehen: Arbeitskreise der eigenen Fachgesellschaft oder deren Jahrestagungen bieten Gelegenheit, wissenschaftliche Gepflogenheiten zu beobachten und sich zu vernetzen, auch wenn man noch nie zuvor auf einer Tagung war.
Der wichtigste Grundsatz dabei: Hör zu, sammel Informationen und denk darüber nach. Nicht alles muss sofort umgesetzt werden, aber das gesammelte Wissen steht zur Verfügung, wenn es benötigt wird.
Wissen teilen und weitergeben
Implizites Wissen entsteht durch Begegnung und Austausch. Wer selbst Erfahrungen gesammelt hat, kann diese mit anderen teilen, als eine mögliche Herangehensweise unter vielen.
Diese Weitergabe muss nicht belehrend erfolgen. Es reicht oft, eigene Erfahrungen zu schildern und anderen die Möglichkeit zu geben, daraus für ihre Situation zu lernen. Wissenschaft profitiert davon, wenn Wissen geteilt wird und nicht in individuellen Erfahrungsschätzen verborgen bleibt.
Wer aktiv Wissen teilt, trägt zu einer offeneren Wissenschaftskultur bei, in der weniger vom Zufall abhängt und mehr Menschen gleichberechtigten Zugang zu wichtigen Informationen haben.
Fazit
Implizites Wissen ist ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Promotion. Statt darauf zu warten, dass dieses Wissen zufällig den Weg zu Dir findet, solltest Du aktiv danach suchen. Vernetz Dich, frage gezielt nach und nutze verfügbare Ressourcen.
Wer die ungeschriebenen Regeln versteht, kann selbstbestimmter durch die Promotionsphase navigieren und mehr Energie für das Wesentliche aufbringen: die eigene Forschung.
Implizites Wissen entsteht durch Austausch, bleib aktiv und in Verbindung mit anderen.
FAQ
Wie erkenne ich, welches implizite Wissen mir fehlt? Achten Sie auf Situationen, in denen Sie sich unsicher fühlen oder nicht wissen, wie Sie sich verhalten sollen. Wenn andere scheinbar mühelos agieren, wo Sie zögern, könnte implizites Wissen im Spiel sein. Reflektieren Sie regelmäßig: Welche Bereiche der Promotion bereiten mir Schwierigkeiten, die nicht direkt fachlicher Natur sind?
Wo finde ich Mentoring-Programme? Informiere Dich bei der Hochschule über offizielle Mentoring-Programme für Promovierende. Falls diese ausgebucht sind oder nicht angeboten werden, kannst du selbst eine Peer-Mentoring-Gruppe mit anderen Promovierenden gründen.
Wie baue ich mir ein wissenschaftliches Netzwerk auf? Beginne mit bestehenden Strukturen: Kolloquien, Tagungen der Fachgesellschaft oder lokale Promotionsgruppen. Sei mutig beim Ansprechen anderer. Online-Plattformen und soziale Medien können ebenfalls Türöffner sein.
Was tue ich, wenn ich mich in Kolloquien unsicher fühle? Beobachte zunächst die Dynamiken, bevor Du Dich beteiligst. Jedes Kolloquium hat seine eigene Kultur. Bereiten Dich gut vor und scheue Dich nicht, nachzufragen, wenn etwas unklar ist.
Welche Online-Ressourcen sind besonders hilfreich? Podcasts und Blogs zu Promotionsthemen vermitteln sowohl explizites als auch implizites Wissen. Der Podcast „Erfolgreich promovieren“ behandelt viele Aspekte der Promotionskultur.