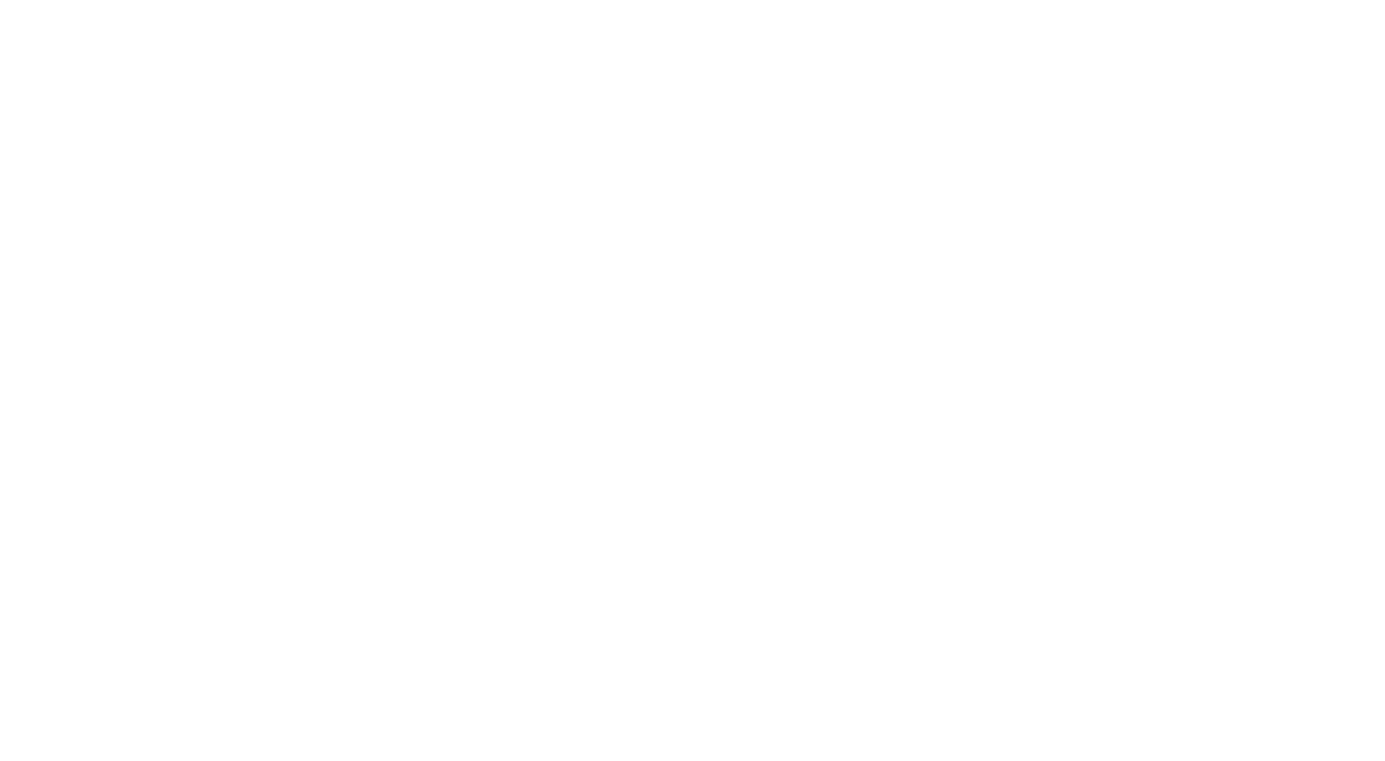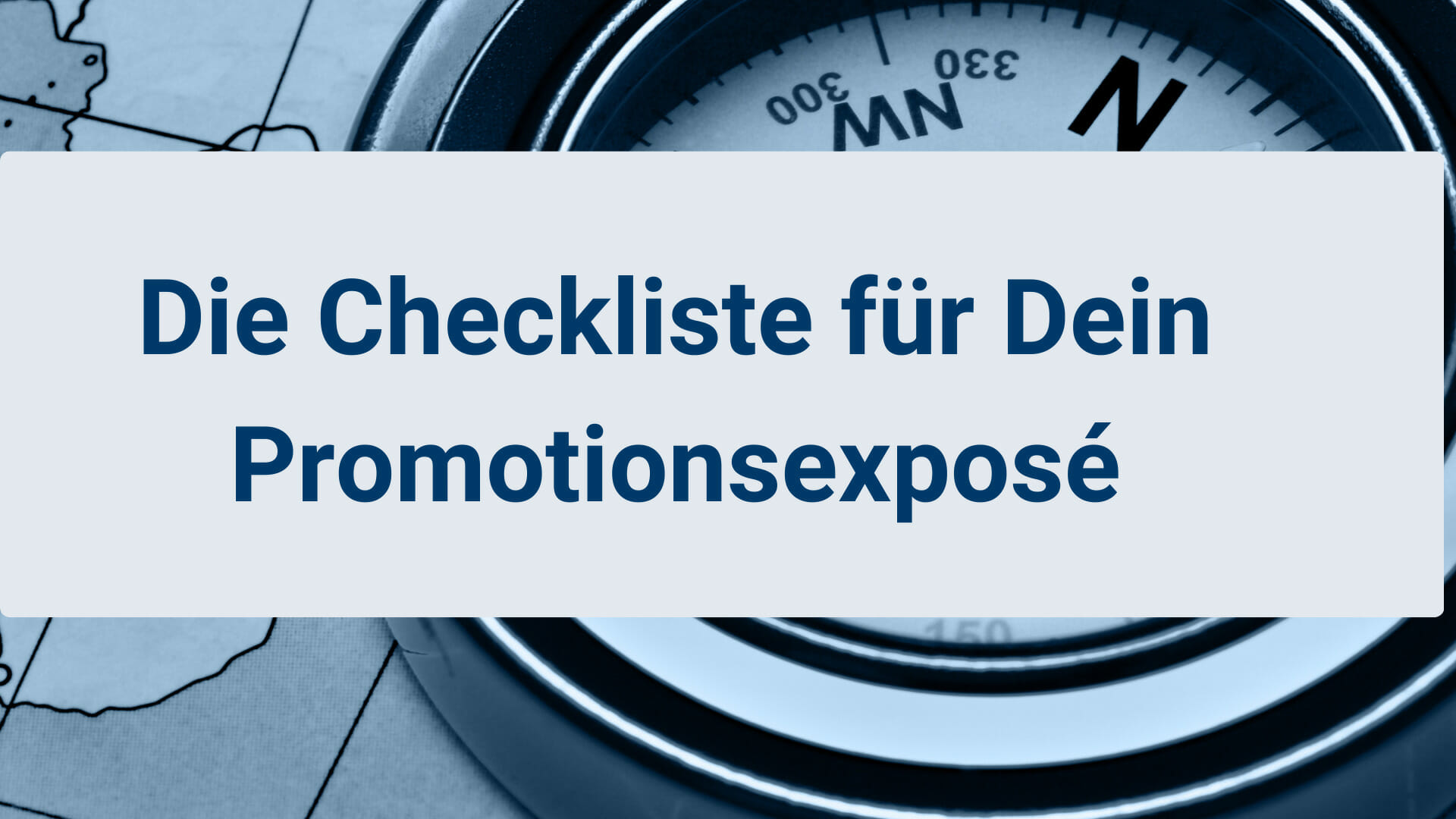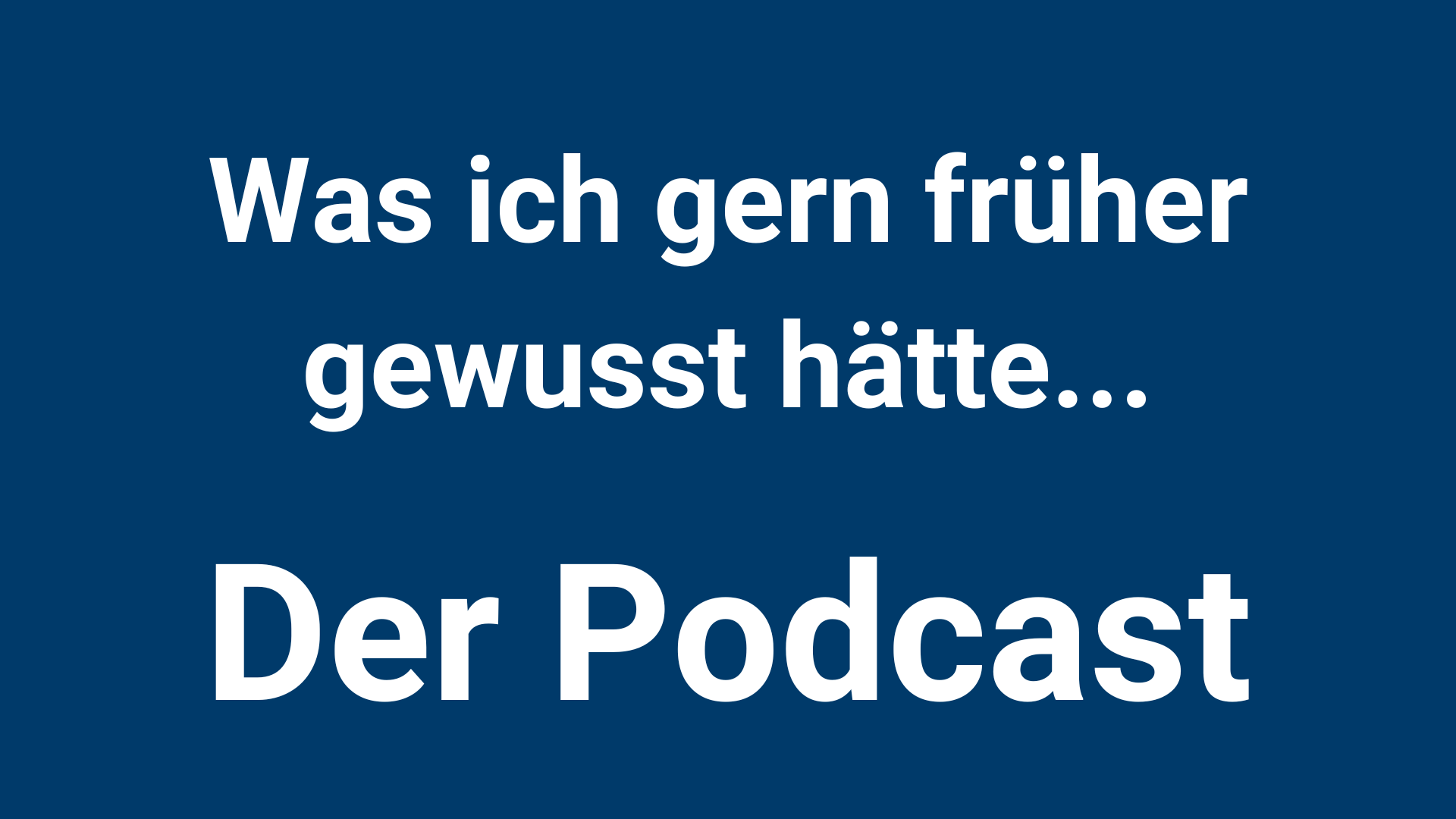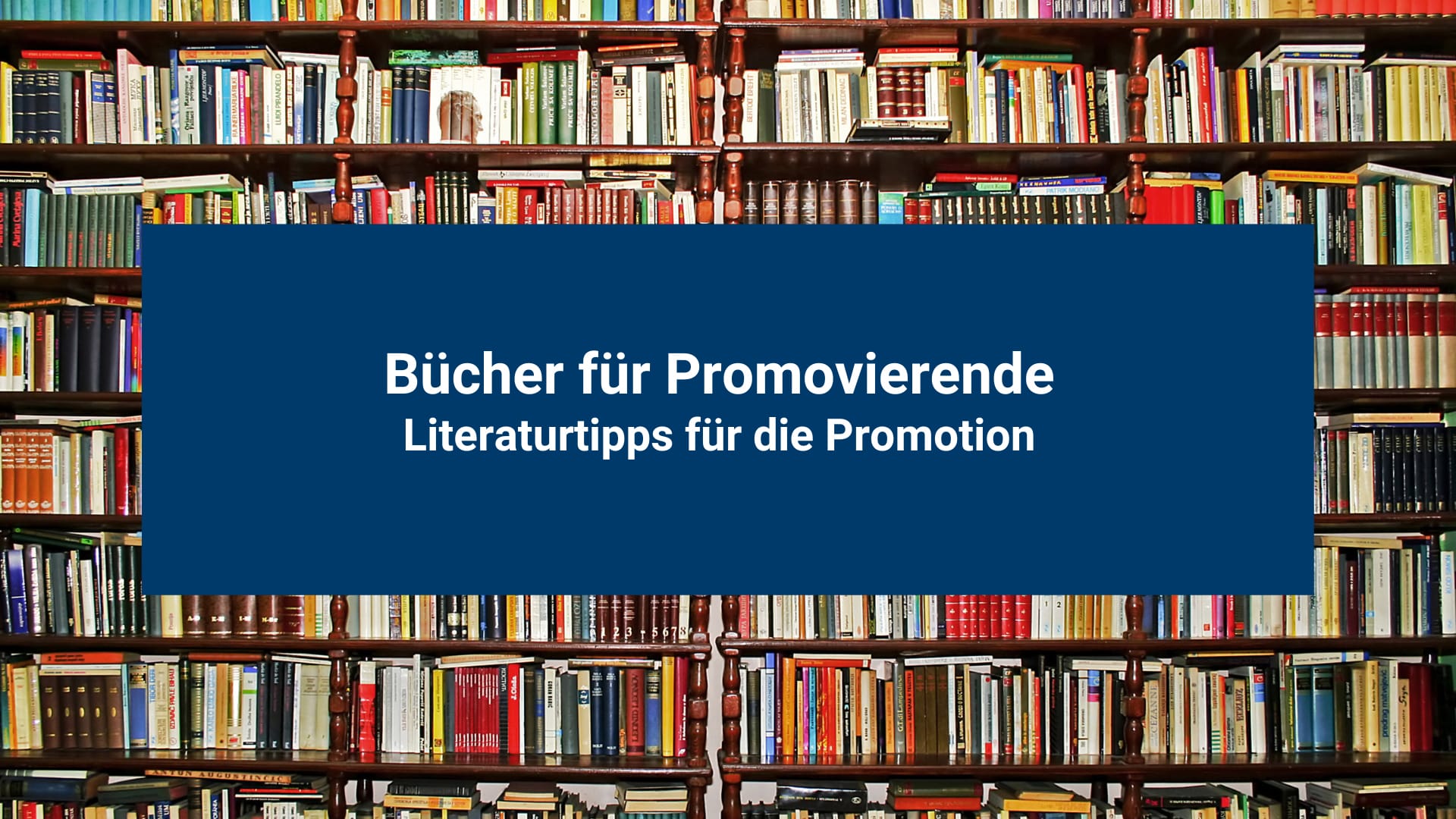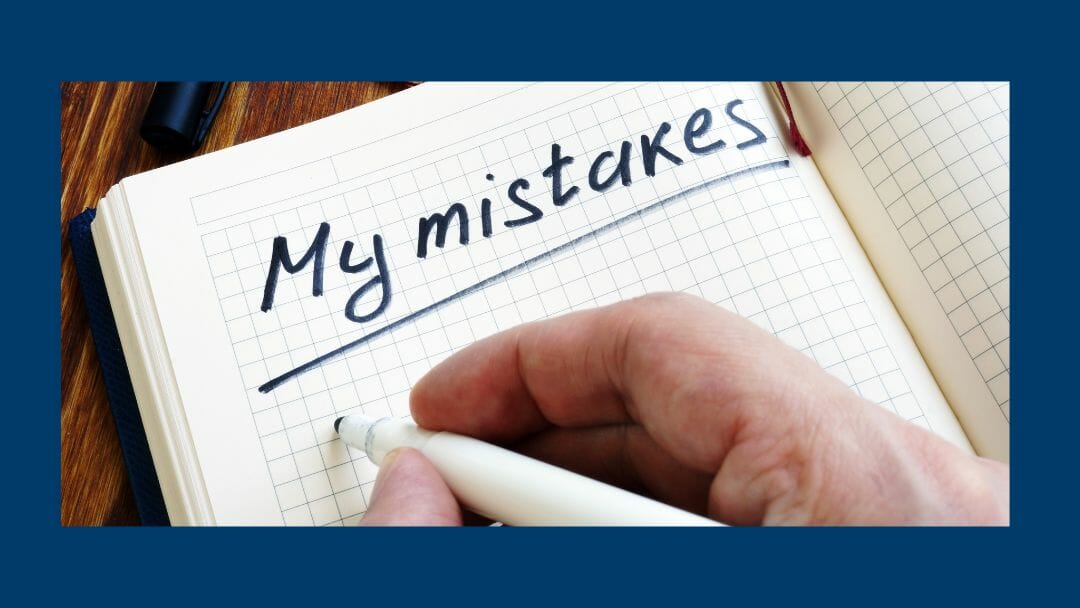
Schreibblockaden während der Promotion sind keine Seltenheit, vor allem dann, wenn Promovierende ihre eigene kritische Stimme immer wieder hören und nicht in den Griff bekommen. Selbstzweifel sind nicht selten Auslöser dieser Schreibblockaden oder Schreibhemmungen, auch oder gerade beim wissenschaftlichen Schreiben.
Die eigene, kritischen Stimme im Schreiben
Viele Promovierende haben eine Schreibhemmung, wenn es um Formulierungen und das Verfassen des Textes für die Dissertation geht. Viele Texte entstehen gar nicht erst, weil der Text von Anfang an möglichst perfekt sein muss (Blogbeitrag Perfektion und Promotion). Da wird die eigene, kritische Stimme während des Schreibens der Doktorarbeit immer lauter und führt zur Schreibblockade.
„Während des Schreibens überlege ich, was alles falsch sein könnte, und höre dann auf.“
In vielen Schreibwerkstätten und Schreibseminaren habe ich erlebt, dass Doktorandinnen und Doktoranden während des Schreibens – und manche auch schon vorher – an ihrer eigenen Kritik scheitern und nicht oder nur sehr mühsam einen Text zustande bringen. Zudem ist die eigene Kritik an sich selbst größer und vernichtender als die Kritik, die von anderen Personen kommt.
Viele Promovierende kennen folgende Aussagen:
„Während des Schreibens überlege ich, was alles falsch sein könnte, und höre dann auf.“
„Vor dem Schreiben denke ich darüber nach, was Person X (seit 20 Jahren Professor*in) darüber denken würde und dann kann ich nicht weiter machen“.
„Es wird sicher Kritik an meiner Argumentation geben, also schreibe ich gar nicht erst“.
„Kann ich jetzt schon schreiben oder muss ich noch mehr lesen?“
„Meine Betreuerin wird denken, dass ich nicht in der Lage bin, eine Dissertation einzureichen“.
Kritik ist der Motor wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns
Kritik ist nicht perse schlecht, denn in der Wissenschaft ist es üblich, Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Zweifel an Ergebnissen gehören zum Prozess des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Dies wird Studierenden bereits zu Beginn ihres Studiums vermittelt. Es gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten, wissenschaftliche Aussagen generell in Frage zu stellen und nach Beweisen und Möglichkeiten zu suchen, die Ergebnisse zu widerlegen. Manche Erkenntnisse überleben sich mit der Zeit selbst und werden durch neuere Erkenntnisse widerlegt, wie z.B. das Buch „Welche wissenschaftliche Idee ist reif für den Ruhestand?“
Das ist der Prozess des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns, er geht immer weiter und irgendwann ist jede Forschung überholt. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind selten allgemeingültig.
Von der Kritik „Motor des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns“ profitieren auch die Promovierenden, schließlich ist dies oft die Motivation zur Promotion. Gäbe es keine Zweifel und Kritik, gäbe es keine Forschungslücke, gäbe es keine Promotion.
Woher kommt die eigene kritische Stimme in der Promotion?
Die Feedbackkultur in der Wissenschaft lässt viele Wünsche und Entwicklungen offen: Wertschätzung ist als Feedback und als Haltung in vielen wissenschaftlichen Arbeitsbereichen eher unüblich. Möglicherweise ist das schnelle Feedback der Arbeitsbelastung und dem hohen Druck von Forschenden und Lehrenden geschuldet – es bleibt wenig Zeit für ein umfassendes, wertschätzendes und motivierendes Feedback.
Hinzu kommt, dass Promotionen in hierarchischen Beziehungen stattfinden. Das Verhältnis zwischen Promovierenden und Betreuenden ist asymmetrisch, da die Betreuenden die Noten vergeben. Über das Feedback wird der Forschungsprozess gesteuert und die Betreuungsperson entscheidet letztlich auch über die Dauer der Promotion. Dies führt dazu, dass sich Promovierende in gewisser Weise immer in einer „Prüfungssituation“ befinden. Dies löst Unsicherheiten und Ängste aus.
Und nicht alle Rückmeldungen auf wissenschaftliche Arbeiten sind durchdacht und fair. Während die meisten Menschen in der Wissenschaft einige Feedback-Regeln kennen, gibt es für den Promotionsprozess in der Regel keine Feedback-Konzepte. Ich möchte an dieser Stelle aber anmerken, dass es auch sehr viele gute Beispiele für wertschätzendes, konstruktives Feedback gibt. Hier ein tolles Poster, Feedback geben und nehmen.
Menschen reagieren oft sensibel auf Feedback. Feedback zum Text/zur Arbeit wird manchmal als Feedback zur Person verstanden. Das ist nicht verwunderlich, zumal Person und Arbeit in der Wissenschaft eng miteinander verwoben sind. Promovierende identifizieren sich in der Regel stark mit ihrer Dissertation, vielleicht weil es das erste eigene Forschungsprojekt ist und oft auch, weil sie ihr Thema aktiv gesucht haben. Feedback trifft daher oft an empfindlichen Stellen.
Zudem ist die Fehlertoleranz in der Wissenschaft sehr gering. Dass dies für Forschungsergebnisse gelten sollte, steht außer Frage – aber Doktorandinnen und Doktoranden sollten im Forschungsprozess Fehler machen dürfen, zumal sie (allein) an ihrem ersten eigenen großen Forschungsprojekt arbeiten. Wissenschaft ist immer auch Teamarbeit – nach dem Humboldtschen Ideal: „In Einsamkeit und Freiheit“ arbeiten die wenigsten.
Schreibblockaden: Mit der eigenen, kritischen Stimme umgehen:
Die eigene, kritische Stimme während des Schreibens der Dissertation ist ein Schreibhemmer – sie gehört aber zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu.
Akzeptiere Deine Zweifel
Akzeptiere, dass Deine Schreibblockaden ein normaler Bestandteil des Schreibprozesses sind und alle Promovierenden davon betroffen sind. Es ist wichtig, sich selbst zu verzeihen und nicht zu hart mit sich ins Gericht zu gehen. Vielleicht gelingt es Dir in Zukunft, Deine eigene kritische Stimme etwas leiser zu stellen, sie nicht so penetrant zu hören. Dazu muss man sich bewusst sein, dass es nicht deine Aufgabe ist, ein perfektes Forschungsergebnis zu liefern. Nicht perfekte, nicht allgemeingültige Forschungsergebnisse sind eine Notwendigkeit in der Wissenschaft – denn ohne Kritik gibt es keinen wissenschaftlichen Fortschritt.
Der Stimme eine andere Stimme geben
Gib der kritischen Stimme in dir eine andere Stimme, zum Beispiel die von Mickey Mouse oder Homer Simpson. Wenn Du eine andere Stimme oder einen anderen Ton anschlägst, wird der innere Kritiker viel weniger glaubwürdig. Generell ist ein bisschen Humor in dieser Situation ganz hilfreich.
Argumentieren und hinterfragen
Wenn der innere Kritiker oder die innere Kritikerin zu laut wird, kannst du auch Gegenargumente finden. Diskutiere mit der Stimme, warum das, was Du tust oder wie Du es tust, gut ist. Generell könntest Du mehr Dinge aufzählen, die Du gut kannst.
Ist das wirklich wahr, was die innere Stimme sagt
Dein Text ist ein Entwurf, bis zum Schluss!
Dein Text kann/muss ein Entwurf sein. Dein Text bleibt so lange ein Entwurf, bis Du Deine Dissertation einreichst. Es sollte Dir klar sein, dass sich Dein Text mit jedem Schreiben und Überarbeiten weiterentwickelt – kaum jemand ist in der Lage, einen druckreifen wissenschaftlichen Text zu schreiben. Mache möglichen Leserinnen und Lesern klar, dass Du den Text als Entwurf verstehst.
Feedback gibt Sicherheit
Hol Dir regelmäßig Feedback ein. Dazu kannst Du Deine Kolleginnen und Kollegen, d.h. andere Promovierende sowie Deine Betreuerinnen und Betreuer bitten.Bitte um Feedback zu konkreten Fragen/Anliegen, z.B. Forschungsfrage, Argumentation des Textes etc. Hier ein Beitrag, wie Du Dir Dein Feedback organisieren kannst.
Werde Mitglied einer Schreibgruppe
Verbinde Dich mit anderen. Gründe eine Schreibgruppe, eine Promotionsgruppe und diskutiere Deine Texte und vielleicht sogar auch Deine Ergebnisse regelmäßig mit anderen Promovierenden, Deiner Schreibgruppe und anderen Forschenden. Einen offenen Schreibraum mit anderen Promovierenden gibt es übrigens bei Fokus-Promotion.
Vertraue Deinem Schreibprozess
Schreiben ist ein komplexer (Entwicklungs-)Prozess: Schreiben entwickelt sich. Schreiber*innen erwerben ihre Schreibkompetenz durch Schreiben. Schreiben ist Training – genau wie Muskeltraining oder Lauftraining wird Dein „Schreibtraining“ Deine Schreibfertigkeiten verbessern, und zwar umso mehr, je öfter Du es tust! (Von nichts kommt nichts).
Schreiben besteht aus verschiedenen Schritten. Planen – Schreiben – Überarbeiten. Und gerade das Überarbeiten macht oft den größten Teil der Arbeit beim Schreiben aus. Entwickle deshalb für Dich eine Schreibroutine, zu der das Verfassen eines Rohtextes und das kontinuierliche Arbeiten gehören – dazu gibt es auch immer wieder Tipps in der Schreibchallenge für Doktorandinnen und Doktoranden. Nicht schreiben hilft nicht!
Denke positiv!
Konzentriere dich auf Menschen und Gedanken, die Dich weiterbringen. Ja, es gibt wirklich Menschen, die schlechte und ungerechtfertigte Kritik üben. Hier ein paar Beispiele für Feedback, bei dem ich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll. Negative Gedanken und Selbstzweifel helfen Dir nicht und bringen Dich nicht voran. Lass es also!
Deine Dissertation ist nur ein Teil Deines Lebens
Die Dissertation ist nur ein Teil des Lebens. Eine Dissertation ist KEIN Lebenswerk. Sei Dir bewusst, dass Deine Forschung eine Lücke füllt und auch wieder eine Lücke hinterlassen wird. Entspanne Dich! Du wirst in Deiner Dissertation wahrscheinlich zu interessanten Ergebnissen kommen – Du wirst wahrscheinlich nicht die Welt erklären – und das sollte auch nicht das Ziel einer Dissertation sein.
Das Allerwichtigste an einer Dissertation ist, dass sie fertig wird! Und darum solltest Du Deine Zweifel hinter Dir lassen. Viel Erfolg dabei:-)